Lassen sich Wachstumsdogma und Umweltschutz vereinbaren? Auch wenn wirtschaftsliberale Kreise an diese Entkopplung glauben, aus Sicht der Kapitalismuskritik ist sie nicht haltbar. Unsere Gastautorin erklärt, warum wir an einer Postwachstumsgesellschaft nicht vorbeikommen werden – und warum das etwas Gutes sein kann.
von Birte Strunk
Der Klimawandel ist seit spätestens 2019 in aller Munde – Greta Thunberg und Fridays for Future haben, zumindest in Europa, erreicht, was Wissenschaftler*innen seit den 70ern verzweifelt versuchen: einen öffentlichen Diskursraum zu schaffen, in dem man an der „Klimafrage“ nicht vorbei kommt. Wie aber steht es um unsere Antworten auf diese Frage? Was ist zu tun, um den Klimawandel einzudämmen?
Um darauf eine Antwort zu finden, muss man zunächst einmal auf die Quelle des Problems schauen. Wie im fünften Weltklimabericht[1] erklärt, sind Klimaforscher*innen inzwischen mit 95% statistischer Sicherheit überzeugt, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Konkreter: ökonomische Aktivitäten, also unsere Produktions- und Konsumweisen, welche sich seit der industriellen Revolution intensivieren, führen dazu, dass sich unser Klima ändert. Wenn wir fossile Brennstoffe verwenden, um Energie zu gewinnen, Plastik herzustellen oder in den Urlaub zu fliegen, wird CO2 freigesetzt. Dadurch erhöht sich die Kohlendioxid-Konzentration in der Erdatmosphäre – laut Umweltbundesamt seit der Industriellen Revolution um 44% –, während sie die 10.000 Jahre zuvor weitgehend konstant war[2]. Die Konzentration dieser Kohlendioxid-Partikel hat wiederum einen Einfluss auf den Strahlungsantrieb – je höher die CO2-Konzentration, desto mehr Wärme bleibt innerhalb der Atmosphäre gefangen, und die Erde heizt sich auf. Zwar erscheinen im grauen Winter in Deutschland zwei Grad mehr gar nicht so schlecht, dennoch haben sie eine große Auswirkung auf die Ökosysteme, die für uns Menschen relevant sind. Unsere Lebensmittelproduktion wird von einem veränderten Klima beeinflusst, die Intensität und Frequenz von extremen Wetterphänomenen nimmt zu, und der Meeresspiegel steigt. Klimawandel geht uns also nicht in erster Linie deshalb etwas an, weil wir „die Natur“ als abstrakte ontologische Kategorie „intakt“ halten wollen. Es geht uns etwas an, weil wir nicht wollen, dass Menschen verhungern oder in Dürren verdursten, dass unsere Häuser überschwemmt werden und Wälder und Tiere verbrennen, oder dass unsere Hafenstädte und Inselstaaten versinken. Und das wiederum ist insbesondere eine Frage der Gerechtigkeit, da die Länder, welche kumulativ am meisten zum jetzigen Schlamassel beigetragen haben – die reichen Länder des Globalen Nordens – nicht diejenigen sind, welche als erste unter den Folgen des Klimawandels leiden.
Entkoppeln statt reduzieren?
Wir wissen also, dass ökonomische Aktivität – vor allem in den reichen Ländern – die Kernursache des Klimawandels ist. Wie können wir mit dieser Einsicht nun eine Antwort auf die Frage „was tun?“ finden? In den 1970ern, als Umweltfragen erstmalig ins öffentliche Bewusstsein internationaler Politik gerieten, waren die ersten Reaktionen recht deutlich: wir müssen unser bisheriges Verständnis von Entwicklung und Wachstum radikal hinterfragen[3]. Diese Einstellung hat leider auf der Ebene internationaler Politik nicht lange überlebt. Während die Cocoyoc Erklärung von 1974 „trickle down economics“ (also die Idee, dass von Wachstum auch die Ärmsten profitieren) noch explizit kritisiert hatte, wurde mit der Brundtland Erklärung 1987 der Weg dafür geebnet, Wachstum (genannt „ökonomische Nachhaltigkeit“) als gleichberechtigtes Ziel neben ökologische Nachhaltigkeit zu stellen. Dass eine intakte ökologische Umwelt überhaupt erst Voraussetzung für wirtschaftliches Handeln ist, wird dabei unterschlagen. In der politischen Realität scheinen wirtschaftliche Argumente im Großen und Ganzen immer noch zu dominieren: Klimawandel einschränken ist super – aber bitte nicht auf Kosten der Wirtschaft.
Prinzipiell gibt es zwei Wege, den Klimawandel einzuschränken: Entweder, wir behalten unsere Art zu produzieren und zu konsumieren bei, versuchen diese aber, von den negativen Umweltfolgen zu entkoppeln, oder wir reduzieren unsere gesamtgesellschaftlichen Produktion- und Konsumniveaus. „Reduzieren“ klingt erstmal bedrohlich für unsere westlichen Ohren, welche geprägt sind von Narrativen des Fortschritts und der Innovation, des weitreichenden Technologieoptimismus, der großen Idee der Moderne, in welcher alles immer nur besser, größer, schneller und mehr wird. Diese Entkopplungsidee passt doch viel besser in unsere Weltsicht – daher sollten wir doch lieber dort ansetzen. Das ist weniger bedrohlich, weniger systemdestabilisierend, weniger pessimistisch. Wie also kann das funktionieren?
Die Idee vom Entkoppeln ist im Grunde simpel: wir wollen mit weniger Resourcen (also weniger Energie, weniger Materialien) dasselbe herstellen, unsere Produktionsprozesse also effizienter gestalten. Wenn wir es durch technologische Innovation schaffen, Ressourcen zu sparen, können wir dieselbe Menge herstellen und dabei weniger verbrauchen – oder mehr herstellen und dasselbe verbrauchen. Und diese Effizienzsteigerungen sind auch in der Tat möglich – zum Beispiel können wir ein bestimmtes Modell eines Autos heute viel energie- und ressourcenschonender herstellen als noch vor 20 Jahren. Jedoch werden diese Effizienzsteigerungen unter heutiger Marktlogik nicht dazu verwendet, tatsächlich weniger zu produzieren. Wenn beispielsweise ein Produktionsinput effizienter wird, sinken auch dessen Kosten, und die Produktion kann dementsprechend angepasst werden. Heute wird also nicht mehr die gleiche Art Autos gebaut wie vor 20 Jahren – sondern SUVs. Und wenn Entkopplungsbefürworter*innen darauf hinweisen, dass die Produktion in westlichen Ländern doch schon längst weniger emissionsintensiv sei, da unsere Wirtschaft zunehmend servicebasiert ist, dann vergessen sie dabei, dass das nur deshalb der Fall ist, weil diese Länder ihre industrielle Produktion inzwischen weitgehend in den Globalen Süden verlagert haben.[4] Gleichzeitig sind wir jedoch diejenigen, die den Großteil der global produzierten Konsumgüter verbrauchen. Das Argument „Aber China!“ funktioniert also leider nicht um, uns als reiche, westliche Nationen aus der globalen Verantwortung zu ziehen.
Die oben beschriebenen Feedbackeffekte nennen sich in der Literatur „Reboundeffekte“, und sind verantwortlich dafür, dass die Entkopplungsstrategie bisher so wenig Erfolg hatte. So sind trotz Pariser Klimaabkommen, Fridays for Future und „grünem“ Konsum die CO2-Emissionen im letzten Jahr schon wieder gestiegen[5]. Reboundeffekte sind allerdings nichts, was sich linke Nachhaltigkeitsforscher*innen ausgedacht haben. Der Mechanismus wurde erstmalig vom neoklassischen Ökonomen Stanley Jevons im 19. Jahrhundert beschrieben, und ist im Mainstream der heutigen VWL (welche ansonsten keine sehr radikalen Antworten auf den Klimawandel zu bieten hat) nicht kontrovers. Was kontrovers ist, ist die Frage, ob die Entkopplungsrate schneller wachsen kann als die Rate, mit der wir ökonomisch expandieren. Neoklassische Umweltökonom*innen sagen: ja, wenn wir nur mehr investieren. Ökologische Ökonom*innen sagen: das versuchen wir seit den 70ern. Fünf Jahrzehnte lang hat das nicht funktioniert. Langsam läuft uns die Zeit davon. Lasst uns vielleicht doch mal über die Möglichkeit der Reduktion von Konsum- und Produktionsniveaus reden – auch, wenn das zunächst unbehaglich klingt.
Abkehr von Kapitalismus und Wachstumsdogma
In erster Linie geht es bei dieser „Reduktions-“Option gar nicht so sehr um blinden, aggressiven Rückbau von Konsum und Produktion, sondern vielmehr um eine Abkehr von der alles umfassenden Expansionslogik des Kapitalismus. Aber, so sagen Postwachstumsforscher*innen, eine Abkehr von dieser Logik hätte zur Folge, dass sich unsere Konsum- und Produktionsmuster radikal ändern würden. Und das muss überhaupt nicht bedrohlich sein – zumindest nicht für 99% der Gesellschaft. Tatsächlich würde erst eine Abkehr von der Expansionslogik Diskursräume öffnen, welche momentan weitgehend verschlossen sind. Momentan wird zum Beispiel immer noch oft davon ausgegangen, dass Armut durch Wachstum und ökonomische Entwicklung bekämpft werden könne – je größer der Kuchen, desto mehr haben alle davon. Ganz abgesehen von der weitreichenden empirischen Literatur, welche zeigt, dass dieser Mechanismus komplett erodiert wurde[6] (falls er je funktioniert hat), eröffnet erst die Abkehr vom Allheilmittel Wachstum neue Möglichkeiten, den Kuchen radikal umzuverteilen. Auch in einer Postwachstumsgesellschaft kann und muss es dabei immer noch weitreichende Investitionen in technologische Innovationen und grüne Energie geben – aber die dahinterliegende Logik ist eine andere: Solidarität und Suffizienz statt Individualismus und Innovation. Anstatt beispielsweise nur von Innovationen zu reden, würden wir in einer Postwachstumsgesellschaft genauso viel über notwendige „Exovationen“ reden, also über Ausstiege z.B. aus der 40-Stunden-Woche, aus der Autoindustrie, aus den ganzen überflüssigen Gütern, die täglich konsumiert und weggeworfen werden. Anstatt davon zu reden, wie „Entwicklungsstaaten“ denn wirtschaftlich „aufholen“ können, könnten wir genausoviel darüber reden, was wir von der Subsistenzwirtschaft und gemeinschaftlich organisierten Commons in nicht-industrialisierten Ländern lernen können. Indem der Klimawandel unsere kapitalistische Produktions- und Konsumweise grundlegend in Frage stellt, öffnet er Möglichkeiten, genau diesen Kapitalismus zu hinterfragen – mitsamt all der Machtverhältnisse, die damit einhergehen. Letzten Endes werden wir nicht daran vorbeikommen, unseren Konsum und unsere Produktion zu ändern – „by design or by desaster“. Postwachstumsbefürworter*innen sprechen sich dafür aus, das emanzipatorische Potenzial der Jahrhundertherausforderung „Klimawandel“ zu nutzen und den Wandel aktiv mitzugestalten.
Birte Strunk
studierte VWL, Politische Philosophie und Nachhaltigkeit in Maastricht, London, New York und Wien. Derzeit arbeitet sie an ihrer Masterthesis zu Ökologischer Makroökonomik am Ecological Economics Institute in Wien. Daneben ist sie aktives Mitglied im Post-growth Economics Network, im Netzwerk Plurale Ökonomik und als Research Fellow beim ZOE Institut für zukunftsfähige Ökonomien aktiv.
Quellenhinweise:
[1] https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full.pdf
[2] https://www.umweltbundesamt.de/daten/klima/atmosphaerische-treibhausgas-konzentrationen#textpart-1
[3] https://www.degrowth.org/wp-content/uploads/2015/07/GOMEZ-NAREDO-In-search-of-lost-time_G%C3%B3mez-Baggethun-and-Naredo-2015.pdf
[4] https://eeb.org/decoupling-debunked1/
[5] https://www.theguardian.com/environment/2019/jan/25/worrying-rise-in-global-co2-forecast-for-2019
[6] https://www.independent.co.uk/news/business/analysis-and-features/the-wealth-that-failed-to-trickle-down-report-suggests-rich-do-get-richer-while-poor-stay-poor-9989183.html

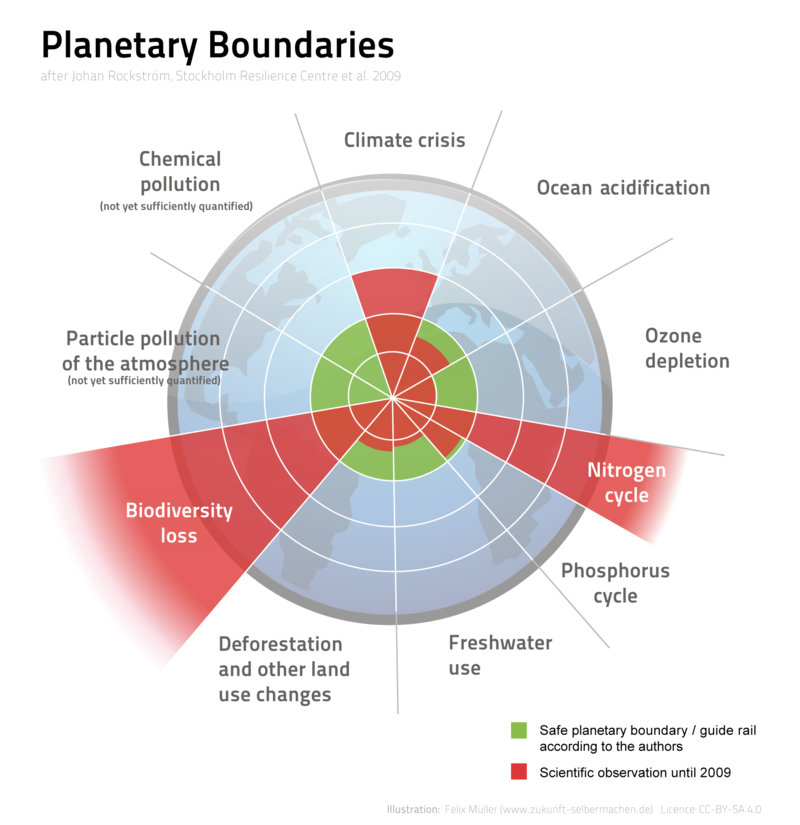
Schreibe einen Kommentar